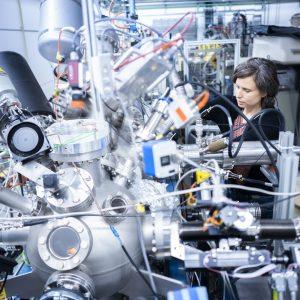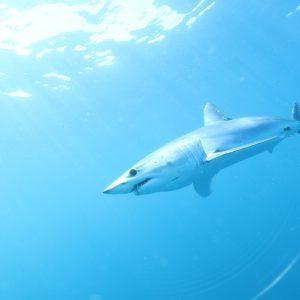WERBUNG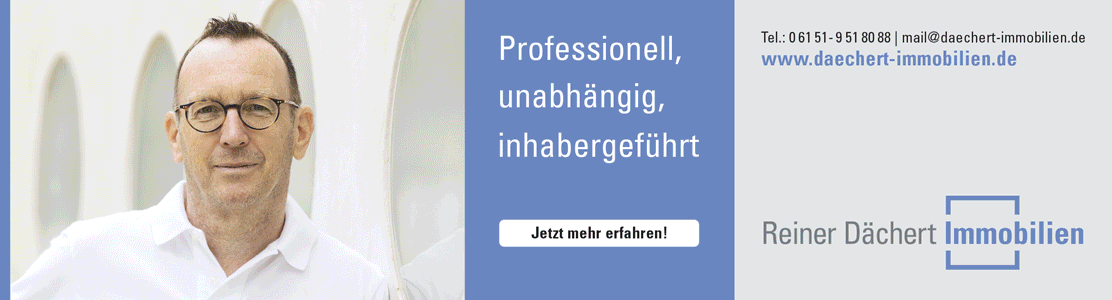
Ein Gespräch mit dem Bildhauer Tony Cragg über seine Werke und die Ausstellung in Darmstadt
Vom 26. April bis 26. Oktober 2025 zeigt der Künstler im Skulpturengarten Darmstadt seine einzigartigen Arbeiten, die mit Material und Form auf faszinierende Weise spielen.
Darmstadt, 25. April 2025. Der britische Bildhauer Tony Cragg zählt zu den bedeutendsten Vertretern der zeitgenössischen Skulptur. Seit den 1970er-Jahren erforscht er in seinem Werk das Zusammenspiel von Form, Material und Raum – oft mit einer fast organisch anmutenden Ästhetik. Seine Skulpturen finden sich weltweit in Museen, Parks und im öffentlichen Raum. Nun sind seine Arbeiten im Skulpturengarten am Spanischen Turm in Darmstadt zu sehen. Wir führten mit ihm ein Gespräch über künstlerische Prozesse, die Kraft der Form – und die Frage, welche Rolle Materie darin spielt.

Ihre Skulpturen wirken oft wie lebendige Organismen, die sich im Raum entfalten. Woher kommt diese Formensprache – gibt es eine bewusste Inspirationsquelle, oder entwickeln sich die Formen intuitiv im Arbeitsprozess?
Mich interessiert an der Bildhauerei, dass sie eine ganz eigene Beziehung zum Material erlaubt – eine, die nichts mit praktischer Nutzung zu tun hat. In unserem Alltag verwenden wir Materialien fast ausschließlich funktional, aber die Bildhauerei gibt dem Material Raum, sich frei zu entfalten – ohne Zweck und ohne Nutzen.
Ich bilde keine Dinge nach, die es schon gibt. Mich interessiert vielmehr: Was lässt sich mit Material noch ausdrücken? Welche Ideen und Emotionen kann man hervorbringen? Ich möchte, dass Menschen beim Betrachten meiner Skulpturen ein Gefühl dafür bekommen, welche Rolle Material in unserem Leben spielt – wie sehr es unsere Umwelt und unser Denken prägt.
Wir unterscheiden gerne zwischen organischer Form – dem, was lebendig, emotional und unregelmäßig erscheint – und geometrischer Ordnung – dem, was technisch, rational und kontrolliert wirkt. Aber in Wahrheit existieren diese Ebenen nicht getrennt. Auch organische Strukturen bestehen letztlich aus geometrischen Einheiten: Molekülen, Zellen, Mustern. Diese Verbindung von Struktur und Empfindung interessiert mich.
In unserer industriellen Welt herrschen oft einfache, effiziente Formen: gerade Linien, glatte Flächen, rechte Winkel. Das hat zu einer gewissen „Verarmung“ der Form geführt. Die Vielfalt, die wir in der Natur finden, geht dabei verloren. Bildhauerei kann hier einen Gegenpol bilden – sie ist eine der wenigen Formen menschlicher Auseinandersetzung mit Material, die keinen äußeren Zweck verfolgt. Sie beginnt mit der Zwecklosigkeit – und genau daraus entsteht ihre Freiheit.
Ich weiß bei keiner Skulptur von Anfang an, wie sie am Ende aussehen wird. Es ist immer ein offener Prozess. Ich arbeite nicht wie ein Designer mit einem klaren Entwurf, sondern lasse mich vom Material und seiner Entwicklung leiten. Oft überrascht mich selbst, was daraus entsteht. Genau das macht es für mich so spannend.
In Ihrer aktuellen Ausstellung in Darmstadt zeigen Sie Werke in einem Skulpturengarten. Welche Rolle spielt der Ausstellungsort für Ihre Arbeiten? Reagieren Ihre Skulpturen auf die Umgebung – oder soll die Umgebung auf sie reagieren?
Der Begriff „Skulpturenpark“ ist in diesem Fall eigentlich irreführend. Es handelt sich zwar um einen Park, aber nicht um unberührte Natur. Vielmehr ist die Umgebung selbst vom Menschen gestaltet: Die Pflanzen, Farben und Wege – all das wurde ausgewählt, arrangiert, komponiert. Insofern finde ich es nur logisch, dass dort auch Skulpturen Platz finden – als eine weitere „Spezies“ unter den vielen menschengemachten Elementen.
Für die Ausstellung in Darmstadt habe ich mir überlegt, wie man sich durch den Raum bewegt. Ich wollte eine Abfolge schaffen, einen Weg, auf dem man von einer Skulptur zur nächsten geleitet wird – wobei jede Skulptur für sich steht, aber zugleich eine visuelle Einladung zur nächsten darstellt. Es geht um Konfrontation und das unmittelbare Erleben von Form im Raum.
Der Park ist für mich in erster Linie ein Raum, ein Ort, an dem meine Arbeiten platziert sind. Ich sehe ihn nicht als Partner, mit dem ich in einen direkten Dialog trete. Die Beziehung zur Natur verarbeite ich eher inhaltlich in meinem Atelier – nicht im Ausstellungskontext im Freien.

Ihre Materialien reichen von Bronze über Holz bis hin zu Kunststoff. Wie entscheiden Sie, welches Material für eine bestimmte Skulptur das richtige ist? Gibt das Material manchmal die Form vor – oder umgekehrt?
Die Wahl des Materials ist in der Bildhauerei nicht einfach eine technische Entscheidung – sie ist zentral für das, was die Skulptur letztlich ausdrückt. Wenn man die Entwicklung der Bildhauerei betrachtet, sieht man: Bis ins späte 19. Jahrhundert wurde fast ausschließlich mit Materialien wie Bronze, Marmor oder Holz gearbeitet – und meist in figurativer Form.
Doch spätestens seit Duchamp wurde klar: Alle Materialien, alle Formen und Farben haben eine Wirkung – intellektuell oder emotional. Wir leben in einer Welt, in der wir permanent von materiellen Eindrücken umgeben sind. Duchamps berühmtes Pissoir war nicht nur Provokation, sondern auch ein Befreiungsschlag: Es zeigte, dass auch Alltagsgegenstände künstlerische Bedeutung erlangen können.
Seitdem hat sich die Bildhauerei zu einem Studium der gesamten Materialwelt entwickelt. Künstler arbeiten heute mit allem – von Schokolade über DNA bis zu Fleisch. Für mich persönlich ist es nicht mehr interessant, einfach nur ein neues Material zu entdecken. Das ist vielfach geschehen.
Wichtiger ist die Frage: Welche Wirkung hat ein bestimmtes Material – und wie kann ich damit eine Form schaffen, die diese Wirkung verstärkt oder hinterfragt? Natürlich spielt auch der Ort eine Rolle. Im Außenraum etwa bin ich auf beständige Materialien angewiesen – Bronze, Stahl, bestimmte Kunststoffe.
Aber jedes Material bringt seine eigene Sprache mit. Stahl steht für Stärke, Stabilität – schon sein Name verweist darauf. Bronze dagegen ist eine uralte Legierung mit niedrigem Schmelzpunkt – ideal, um feine, komplexe Formen zu gießen. Und Glas? Das ist eine Welt für sich: Wenn ich mit Glasmachern arbeite, bringt das Material oft seine eigene Geometrie mit – Tropfen, Stränge, ganz natürlich gewachsene Strukturen.
Mich interessiert genau das: das Wechselspiel zwischen der Idee und dem, was das Material von sich aus mitbringt. Manchmal gibt die Form die Richtung vor – aber sehr oft entsteht sie im Dialog mit dem Stoff selbst.
Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit dem Verhältnis von Materie und Form, von Natur und Kultur. Hat sich Ihr Blick auf diese Themen im Laufe der Jahre verändert?
Mein Blick auf das Verhältnis von Materie und Form hat sich im Laufe der Jahre verändert – nicht durch plötzliche Brüche, sondern eher als fließende Entwicklung. Als ich 1969 begann, Skulpturen zu machen, hatte ich keine klare Vorstellung davon, was Bildhauerei überhaupt sein könnte. Ich war einfach fasziniert von der Wirkung von Formen – und wollte mit neuen Materialien experimentieren.
Damals arbeitete ich mit Kunststoffen, die in der Kunstwelt noch kaum beachtet wurden. Ich sammelte industrielle Objekte mit einfachen Geometrien und begrenzter Farbigkeit – alles wirkte wie aus einer einzigen Quelle. Daraus entstand für mich die Frage: Was sagen diese gleichförmigen Massenprodukte über unsere Welt aus?
Ich begann, sie zu sortieren, zu stapeln, farblich zu kombinieren – und entwickelte ein wachsendes Bedürfnis, eigene, komplexe Formen zu schaffen. Nicht als Abbilder, sondern als eigenständige Gebilde. So entstand etwa die Idee, den Schatten eines Gefäßes nachzubilden – etwas, das nicht greifbar, aber sichtbar ist.
Die Serie Early Forms war schließlich inspiriert von fossilen Fundstätten, an denen zahlreiche ausgestorbene Tierarten gleichzeitig entdeckt wurden – eine Metapher für die riesige Vielfalt an Formen, die es einmal gab oder geben könnte.
Später habe ich mich zunehmend mit dem Spannungsfeld zwischen geometrischer Struktur und organischer Form beschäftigt. Diese Entwicklung verlief nie sprunghaft, sondern in logischen, aufeinander aufbauenden Schritten.
Trotz aller Veränderungen ist eines gleich geblieben: mein Staunen über das Materielle – über chemische, physikalische und formale Eigenschaften. Diese Faszination begleitet mich seit mehr als fünf Jahrzehnten – und sie ist nach wie vor ungebrochen.

Wenn Sie an eine neue Skulptur herangehen: Beginnt der Prozess im Kopf, auf dem Papier, oder direkt mit dem Material in der Hand?
Für mich beginnt eine neue Skulptur nicht mit einer plötzlichen Eingebung oder klassischen Inspiration – das ist ein Begriff, den ich ehrlich gesagt nie ganz verstanden habe. Vielmehr entsteht eine neue Arbeit fast immer aus der vorherigen. Während man an einer Skulptur arbeitet, trifft man eine Vielzahl von Entscheidungen, manche eher klein, andere wiederum zentral – etwa die Frage, ob eine Form drei oder vier Beine hat.
Wenn ein Werk vollendet ist, bleibt im Kopf eine Art Erinnerung an den Weg dorthin. Man beginnt zu ahnen: Hätte ich an einer Stelle anders entschieden, wäre etwas völlig anderes entstanden – mit einer anderen Form, einer anderen Bedeutung, einer anderen emotionalen Qualität. Und genau dieser Gedanke führt zur nächsten Skulptur.
Man möchte sehen, was passiert, wenn man den anderen Weg geht. Aber auch dann entdeckt man wieder etwas Neues, Ungeplantes. Man landet an einem Ort, den man gar nicht vorhersehen konnte. Das Schöne ist: Es gibt noch so viel Unentdecktes in der Welt – und in der Kunst. Ich habe das Gefühl, dass alles gerade erst anfängt.