WERBUNG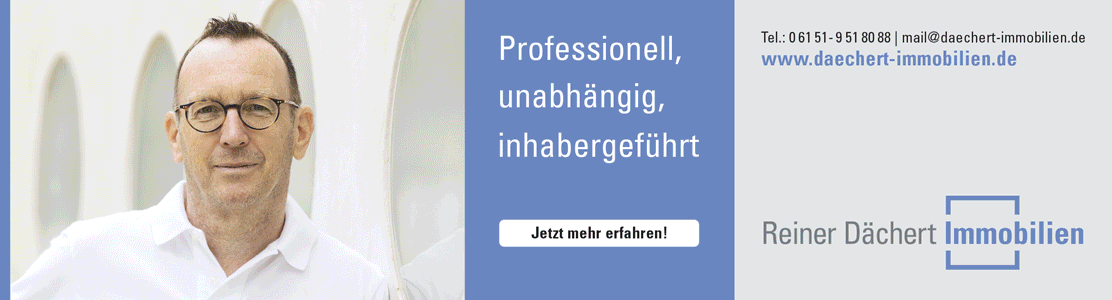

Dr. Tim Flohrer von der ESA in Darmstadt über die wachsende Bedrohung durch Trümmer im All und die dringenden Maßnahmen für eine nachhaltige Raumfahrt
Was passiert eigentlich mit künstlichen Flugkörpern im Weltraum, wenn sie nicht mehr funktionieren? Seit 1957 wurden über 6.000 Satelliten in die Erdumlaufbahn gebracht, von denen aber nur mehr etwa 800 funktionstüchtig sind. Der Rest kreist als Weltraumschrott um die Erde, zusammen mit kaputten Raketenteilen und anderen Trümmerteilen aus der Raumfahrt. Laut Schätzungen der Europäische Weltraumorganisation (ESA) gibt es derzeit über 700.000 solcher Objekte, die größer als ein Zentimeter sind und sich mit rasender Geschwindigkeit in der Erdumlaufbahn bewegen. Dr. Tim Flohrer leitet das Space Debris Office der ESA in Darmstadt und ist eine zentrale Figur im Bereich der Weltraumsicherheit. In seiner Rolle überwachte er die Entwicklung und Verbreitung von Weltraumschrott, analysierte potenzielle Gefahren und entwickelte Strategien, um das Risiko von Kollisionen im All zu verringern. Ein wichtiger Teil seiner Arbeit ist die Koordination internationaler Maßnahmen und die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Ingenieuren, um innovative Technologien zur Müllbeseitigung und Prävention zu fördern. Flohrer engagiert sich dafür, den Orbit nachhaltiger zu gestalten und die Sicherheit für zukünftige Raumfahrtmissionen zu gewährleisten. Wir haben mit ihm in den Räumen der ESOC in Darmstadt gesprochen.
Herr Flohrer, Wie ernst ist das Problem des Weltraumschrotts derzeit und wie beeinflusst es die zukünftige Nutzung des Weltraums?
In den späten 1970er Jahren veröffentlichte der NASA-Wissenschaftler Donald J. Kessler ein Paper, in dem er aufzeigte, dass es zu einer Kettenreaktion von Kollisionen und Fragmentationen von Weltraumobjekten kommen könnte. Das Thema beschäftigte also zunächst nur die Wissenschaft. Später setzten sich zunehmend Akteure & Betreiber der Raumfahrt damit auseinander. Im Februar 2009 ereignete sich die erste Satellitenkollision in der Erdumlaufbahn. Spätestens hier rückte das Thema ins breite öffentliche Interesse und seit 2-3 Jahren nimmt man es sogar als Umweltproblem wahr, vor allem die jüngere Generation. Tatsächlich beeinflusst „Weltraumschrott“ die Raumfahrt in vielen Dimensionen. Kollisionen könnten nicht nur zu Funktionsausfällen führen, sondern auch zu erheblichen Kostensteigerungen für Raumfahrtunternehmen und einem substanziellen Risiko für bemannte Raumfahrtmissionen.
Welche konkreten Maßnahmen ergreift die ESA, um die zunehmende Menge an Weltraumschrott zu reduzieren oder zu beseitigen?
Wir sind als sozusagen „zwischenstaatliche Organisation“ stark mit der Entwicklung und der Modulation des Problems beschäftigt. Dabei treten wir als Beispielgeber, als gutes Vorbild für andere Betreiber auf. Der Weltraum ist längst kein wissenschaftlicher Raum mehr. Mehr als 90% sind kommerzielle Akteure, denken Sie nur an Elon Musk (SpaceX). Über 100 Nationen nutzen Satelliten. Das liegt daran, dass die Kosten für Weltraumprogramme deutlich gesunken sind. Als „Guideline“ haben wir 2023, aufbauend auf jahrzehntelanger Arbeit, daher die Zero Debris Charter gestartet, um die Anzahl der Raumfahrtrückstände in der Erd- und Mondumlaufbahn bis 2030 für alle künftigen Missionen, Programme und Aktivitäten der Agentur erheblich zu begrenzen. Die ESA setzt auf technologische Innovationen, klare Richtlinien und internationale Kooperation, um dieses Ziel zu erreichen. Denn eins muss uns klar sein: Der Weltraum, so groß er auch scheint, ist eine begrenzte Ressource, vergleichbar mit Trinkwasser.
Gibt es konkrete Beispiele für Weltraummissionen oder Technologien, bei denen die ESA erfolgreich zur Reduzierung von Weltraumschrott beigetragen hat?
Wir haben weltweit führende Modelle der „Space Safety“ zur aktiven Entfernung von Weltraummüll in Darmstadt entwickelt. So etwa die geplante ClearSpace-1 -Mission, bei der erstmals ein defektes Satellitenbauteil eingefangen und kontrolliert zum Absturz gebracht werden soll. Diese Mission dient als Prototyp für zukünftige Aufräumaktionen im All.
Darüber hinaus setzt die ESA auf präventive Maßnahmen, indem sie neue Richtlinien für die Konstruktion von Satelliten entwickelt, die sicherstellen, dass nach Missionsende keine Trümmer im Orbit zurückbleiben. Dazu gehört die Verpflichtung, Satelliten so zu bauen, dass sie sich nach Ende ihrer Lebensdauer selbstständig aus dem Orbit entfernen. Durch diese kombinierte Strategie aus Überwachung, Prävention und gezielter Entsorgung setzt die ESA aktiv auf eine nachhaltige Nutzung des Weltraums.
Wie arbeitet Ihr Büro in Darmstadt mit internationalen Partnern zusammen, um eine globale Strategie zur Bekämpfung von Weltraumschrott zu entwickeln und gibt es rechtliche oder politische Herausforderungen, denen die ESA bei der Weltraumschrottbekämpfung gegenübersteht, insbesondere im internationalen Kontext?
Unser Weltraumrecht stammt aus den 1970er- und 1980er-Jahren und ist in seiner aktuellen Form nicht auf das Problem des Weltraumschrotts ausgerichtet. Die erarbeiteten Richtlinien zur Minimierung von Weltraummüll sollten dringend in internationales Recht überführt werden. Dabei ist die Bedeutung dieser Umsetzung für manche Länder besonders hoch, während andere weniger betroffen zu sein scheinen. Dennoch bleibt das Risiko, das von Weltraumschrott ausgeht, für alle gleich – eine globale Herausforderung, die gemeinsames Handeln der Nationen erfordert.
Umso wichtiger ist die Entwicklung und der Stellenwert der Zero Debris Charter, die von der ESOC in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren der Raumfahrtbranche erarbeitet wurde. Sie definierten sowohl übergeordnete Leitprinzipien als auch spezifische Ziele, um bis zum Jahr 2030 die Menge an Weltraumschrott signifikant zu reduzieren. Mehr als 100 Unterzeichner unterstreichen den Willen von Staaten und Betreibern, Nachhaltigkeit und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Weltraum als ernst zu nehmende Themen zu behandeln.
Welche Rolle spielt die Zusammenarbeit mit privaten Raumfahrtunternehmen bei der Eindämmung von Weltraumschrott, und wie wirkt sich der zunehmende Weltraumtourismus auf dieses Thema aus?
Die Koordination mit kommerziellen Betreibern, wie beispielsweise Elon Musk, ist von enormer Bedeutung, da der kommerzielle Anteil an Dienstleistungen im Weltraum stetig zunimmt. Die Menge und Vielfalt an Satellitendaten wachsen rasant, etwa in Bereichen wie Telekommunikation oder Diensten wie Google Maps. Auch wenn der Weltraumtourismus derzeit auf deutlich tieferen Umlaufbahnen stattfindet und Rückstände hier schneller verglühen, erfordert die wachsende Nutzung des Weltraums eine enge Zusammenarbeit, um die Sicherheit für ESOC-Missionen und Projekte anderer Akteure zu gewährleisten.
Welche langfristigen Strategien und Innovationen plant die ESA, um das Problem des Weltraumschrotts in den nächsten Jahrzehnten zu bekämpfen?
Die weitere Entwicklung zur Eindämmung des Weltraumschrotts setzt verstärkt auf innovative Technologien in den sogenannten „Orbit Services“. Hierbei wird der Fokus auf die Umstellung von einer linearen hin zu einer Kreislaufwirtschaft gelegt, um Satelliten im All zu reparieren, umzubauen oder aufzurüsten, anstatt sie nach ihrer Lebensdauer unkontrolliert als Schrott zurückzulassen. Diese Ansätze zielen darauf ab, die begrenzte Ressource „Weltraum“ effizienter zu nutzen, denn der Raum wird immer enger und das Kollisionsrisiko steigt. Durch die Reparatur und den Umbau von Satelliten soll nicht nur die Nachhaltigkeit gesteigert, sondern auch die Lebensdauer der Geräte verlängert werden. Gleichzeitig entsteht die Herausforderung, nachhaltige und finanzierbare Geschäftsmodelle zu entwickeln, um die Kosten solcher komplexen Missionen zu decken.














